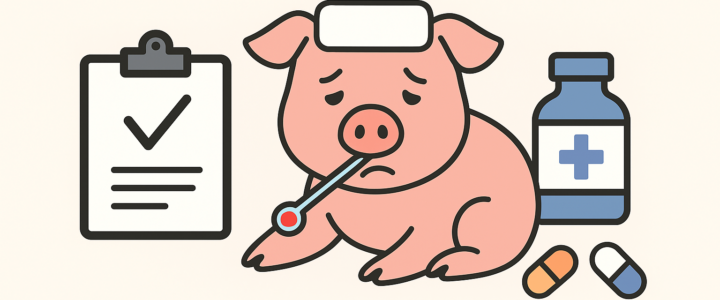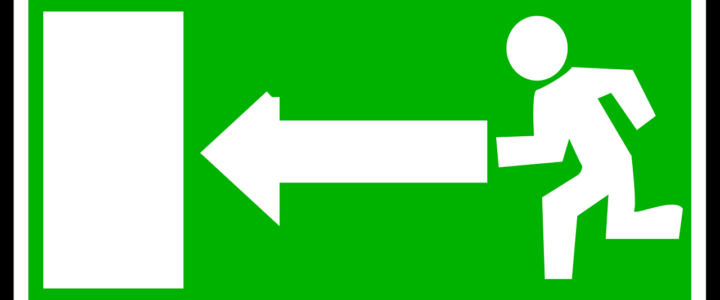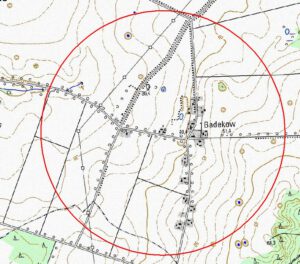Tierseuchengefahren haben sich erhöht
Selten hatten wir in der Vergangenheit mit einem fast zeitgleichen Ausbruch verschiedener Tierseuchen in unseren Haustierbeständen, wie der Geflügelpest, der Afrikanischen Schweinepest, der Maul- und Klauenseuche oder auch der Blauzungenkrankheit, zu tun. Diese Situation stellt alle Tierhalter, egal ob in Hobbyhaltungen oder in gewerblichen Haltungen, vor große Herausforderungen. In diesem Zusammenhang nimmt die Biosicherheit in allen Tierhaltungen einen immer höheren Stellenwert ein.
1. Was versteht man unter Biosicherheit und wie sollte sie umgesetzt werde?
Diese Frage sollten sich alle Tierhalter stellen und die Abläufe in ihrer Tierhaltung regelmäßig kritisch hinterfragen.
Unter Biosicherheit versteht man alle Maßnahmen, die das Risiko der Einschleppung und Ausbreitung von Krankheitserregern in oder aus Tierhaltungen reduzieren sollen. Ziel der Maßnahmen ist es, die Gesundheit und das Wohlbefinden von Tieren und Menschen zu gewährleisten.
Biosicherheit gewährleisten und dokumentieren
Das EU-Tiergesundheitsrecht (AHL) verpflichtet jeden Tierhalter und jede Tierhalterin, (in den Rechtsvorschriften als „Unternehmer“ bezeichnet), unabhängig von der Größe der Tierhaltung, diese vor biologischen Gefahren (Eintrag von Krankheitserregern) zu schützen und die ergriffenen Maßnahmen zu dokumentieren.
Das Einhalten der rechtlichen Vorgaben ist für alle Tierhaltungen mit Nutztieren wichtig, weil die Leistungen der Tierseuchenkasse und der EU im Tierseuchenfall davon abhängig sind.
Im Falle des Ausbruchs einer Tierseuche in einer Tierhaltung ist deshalb zukünftig mit den Antragsunterlagen der Biosicherheitsmanagementplan durch den Tierhalter bei der Tierseuchenkasse M-V vorzulegen. Bei Fehlen eines Planes kann es im Tierseuchenfall zu Kürzungen von Entschädigungsleistungen kommen.
Dies trifft insbesondere ab dem 01.01.2026 zu bei:
Geflügelhaltungen ab 1.000 Tiere und
Schweinehaltungen ab 20 Tiere.
Ab dem 01.1.2027 bei:
Rinderhaltungen ab 20 Tiere und
Schaf- und Ziegenhaltungen ab 20 Tiere.
2. Verpflichtungen für alle Tierhalter
Jeder Halter von Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen und Geflügel muss den Schutz vor biologischen Gefahren in seiner Tierhaltung sicherstellen.
Angemessene Biosicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Tierbestandes umfassen insbesondere:
- Umzäunung, Einfriedung, Überdachung, Errichtung von Netzen
- Reinigung, Desinfektion, Schadnagerbekämpfung
- Verfahren, die regeln, wie Tiere, Erzeugnisse, Fahrzeuge und Personen in und aus den Betrieb gelangen
- Verfahren für die Nutzung von Ausrüstung
- Quarantäne, Isolation und Absonderung von neu eingestellten oder kranken Tieren
- ein System zur sicheren Lagerung und Beseitigung von Tierischen Nebenprodukten
Für die Früherkennung von Tierseuchen muss jeder Tierhalter über Kenntnisse zu Tiergesundheit und Tierseuchen der von ihm gehaltenen Tiere verfügen und sich der Übertragungsgefahr von Tierseuchen auch auf den Menschen bewusst sein.
Jeder Tierhalter muss also im Vorfeld eine Risikoanalyse für seine Tierhaltung vornehmen, um dann zu entscheiden, ob und welche Maßnahmen zum Schutz seiner Tiere zu ergreifen sind. Die Maßnahmen sind in geeigneter Form zu dokumentieren (Biosicherheitsmanagementplan), regelmäßig zu überprüfen und anzupassen.
Hier stellen wir Ihnen das Biosicherheitskonzept für kleine Tierhaltungen zur Verfügung.
Ihr Tierarzt, Ihre Tierärztin und Ihr zuständiges Veterinäramt steht Ihnen beratend zur Seite.
3. Tiergesundheitsbesuche und Dokumentation
Jedem Tierhalter ist die Pflicht übertragen, „Tiergesundheitsbesuche“, also tierärztliche Kontrollen und Beratungsleistungen, in Anspruch zu nehmen. Die Häufigkeit dieser Besuche richtet sich nach dem Risiko für die Tiergesundheit, die die jeweilige Tierhaltung birgt. Ein niedriges Risiko wäre beispielsweise in einem in sich geschlossenen Betrieb mit hoher Biosicherheit zu erwarten. Ein höheres Risiko muss in Tierhaltungen angenommen werden, die z. B. häufig zu- und verkaufen.
Der Zweck dieser Tiergesundheitsbesuche ist es, die Seuchenprävention zu verbessern durch:
- fachkundige Beratung in Fragen der Biosicherheit und anderer Tiergesundheitsaspekte und
- Feststellung von Anzeichen für das Auftreten gelisteter oder neu auftretender Seuchen und Vermittlung von Informationen über diese Krankheiten.
4. Ausblick bei der Tierseuchenkasse M-V
Voraussetzungen für Leistungen der Tierseuchenkasse M-V im Tierseuchenfall sind:
- Korrekte Tierzahlmeldung und Nachmeldung
- Korrekte und fristgerechte Zahlung der Beiträge
- Rechtskonformes Verhalten
5. Linksammlung
Das gehäufte Auftreten auch von neuen Tierseuchen und die damit verbundenen hohen wirtschaftlichen aber auch emotionellen Schäden für alle Tierhalter, zeigen die Verantwortung jedes Einzelnen, der mit Tieren umgeht. Jede Verbesserung der Biosicherheit in den Tierhaltungen ist positiv!
Es ist also wichtig, dass sich jeder Tierhalter mit dem Thema beschäftigt und Stück für Stück Verbesserungen schafft.
Überprüfen Sie die Biosicherheit Ihres Tierbestandes beispielsweise nach:
6. Rechtsgrundlagen zur Biosicherheit[1]
Mit den nachfolgend genannten Rechtsgrundlagen werden die Verantwortungen für die Biosicherheit in die Hände der Tierhalter gelegt:
- Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit im Merkblatt Tiergesundheitsrecht (AHL) genannt,
- Gesetz zur Vorbeugung vor und Bekämpfung von Tierseuchen
im Merkblatt Tiergesundheitsgesetz
Nach Artikel 10 und Erwägungsgrund 43 des Tiergesundheitsrechts (AHL) sollen die getroffenen Maßnahmen zum Schutz vor biologischen Gefahren ausreichend flexibel und auf die Art der Produktion sowie die betreffenden Tierarten und -kategorien abgestimmt sein. Weiterhin sollen sie den lokalen Gegebenheiten, technischen Entwicklungen und betriebsindividuellen Risikofaktoren Rechnung tragen. Für die meisten Handlungsbereiche wird zwischen „Baulichen Gegebenheiten“ und „Management“ unterschieden.
Nutzen Sie auch das Biosicherheitskonzept für kleine Tierhaltungen .
Dieser Tierseuchenmaßnahmenplan sollte auch in Ihrem Stall hängen.
[1] Alle Ausführungen in diesem Informationsblatt sind rechtlich unverbindlich. Verbindlich sind allein die Vorgaben der zitierten Rechtsvorschriften und deren Auslegungen durch die europäischen und nationalen Gerichte.