Die Paratuberkulose des Rindes ist verursacht hohe wirtschaftliche Verluste in rinderhaltenden Betrieben. Hier erfahren Sie viel über die Krankheit, die Diagnostik und ihre Bekämpfung.
https://www.vet-consult-elearning.de/course/2

Die Paratuberkulose des Rindes ist verursacht hohe wirtschaftliche Verluste in rinderhaltenden Betrieben. Hier erfahren Sie viel über die Krankheit, die Diagnostik und ihre Bekämpfung.
https://www.vet-consult-elearning.de/course/2

Die Coxiellose des Rindes ist aufgrund des Zoonoserisikos trotz eines vorrangig gutartigen Krankheitsverlaufs eine ernstzunehmende Infektionskrankheit. Die Erregerausscheidung mit der Milch und beim Kalben ist mit unterschiedlichen Infektionsrisiken für den Menschen verbunden. Insbesondere Rinderhaltungen mit landwirtschaftsfernem Personenverkehr sollten daher Maßnahmen zur Eindämmung einer möglichen Infektionsgefährdung des Menschen ergreifen. Hygienemaßnahmen, die Entfernung chronisch infizierter Tiere und betriebsindividuelle Impfkonzepte sind geeignet, das Infektionsrisiko zu senken. Bei schweren grippalen Infekten des Menschen ist eine differentialdiagnostische Untersuchung auf Q-Fieber zu empfehlen.
In Deutschland wird immer wieder im Zusammenhang mit der Haltung vorwiegend von Schafen, aber auch von Ziegen oder Rindern über das Auftreten von Q-Fieber beim Menschen berichtet. Meist handelt es sich dabei um sporadische Fälle. Bundesweit auftretende einzelne Q-Fieber-Ausbrüche beim Menschen wie auch das vergleichsweise große Infektionsgeschehen in den Niederlanden im Zusammenhang mit Milchziegenhaltungen (2007-2009) weisen der Coxiellose für die Wiederkäuerhaltung eine besondere Bedeutung zu. Weiterhin ist der Tatsache, dass Coxiellen in der Milch von Wiederkäuern nachgewiesen werden, Rechnung zu tragen. Das Infektionsrisiko über Rohmilch ist zwar nicht auszuschließen, aber als vergleichsweise gering einzustufen, da eine orale Infektion im Vergleich zur aerogenen Infektion einer sehr viel höheren Infektionsdosis bedarf. Außerdem geht von kommerziell pasteurisierter Milch kein Infektionsrisiko aus.
Beim Q-Fieber (engl. Q = query = Frage, Zweifel) handelt es sich um eine beim Menschen meldepflichtige, bakteriell bedingte Infektionskrankheit, die durch Coxiella burnetii hervorgerufen wird.
Die Erkrankung beim Tier wird als Coxiellose bezeichnet und ist bei allen Wiederkäuern meldepflichtig. Als Zoonose kann die Infektion auf natürliche Weise zwischen Wirbeltieren und Menschen übertragen werden. Exponierte Berufsgruppen sind primär Schaf-, Ziegen- und Rinderhalter, Tierärzte und weitere Personengruppen mit berufsbedingten Kontakten zu den genannten Tieren (Schlachthofmitarbeiter, Besamungstechniker usw.). Mögliche Infektionen landwirtschaftsferner Personengruppen (z.B. Besucher, Feriengäste auf dem Bauernhof etc.) sind aufgrund der indirekten Erregerübertragung (kontaminierter Staub, kontaminierte Kleidung) unbedingt zu berücksichtigen. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass bei größeren Ausbrüchen in der Humanmedizin meistens landwirtschaftsferne Personen betroffen waren.
Tragende Tiere stehen im Mittelpunkt des Infektionsgeschehens, da sich Coxiellen bevorzugt und sehr stark in den Fruchthäuten vermehren. Vor allem bei der Geburt können dann hohe Erregermengen mit der Nachgeburt und dem Fruchtwasser freigesetzt werden. Trocknen die Geburtsnebenprodukte ein, so bildet der Erreger ein sporenähnliches Dauerstadium aus, welches lange infektiös bleibt (Wolle bis 16 Monate, Staub bis 120, Urin bis 49 und Speichel bis 30 Tage). So sind Infektionen vor allem zeitnah zur Geburt möglich. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch unabhängig von einer Geburt wurde bislang nicht beschrieben.
Den Zecken der Gattung Dermacentor wurde in der Vergangenheit beim Schaf eine besondere Rolle zugeschrieben, da infizierte Zecken hohe Erregermengen mit dem Kot ausscheiden. Eingetrockneter erregerhaltiger Zeckenkot gilt als eine Infektionsquelle. Allerdings werden nur selten infizierte Zecken gefunden. Der Fokus der Infektionsvermeidung liegt also um den Geburtszeitraum.
Grundsätzlich neigt die Coxiellen-Infektion beim Rind zu einem gutartigen Verlauf mit milden oder auch ohne Krankheitserscheinungen. Es werden aber auch Verläufe mit (Spät-)Aborten, Frühgeburten, Geburt lebensschwacher Jungtiere und Fruchtbarkeitsstörungen beobachtet.
Auch beim Menschen steht der gutartige Infektionsverlauf bei mehr als der Hälfte der Betroffenen im Vordergrund. In ca. 40% der Fälle treten nach einer 2-4 wöchigen Inkubationszeit unspezifische Grippe-ähnliche Symptome auf, die auch ohne Behandlung nach ein bis zwei Wochen wieder abklingen. Schwerere Verläufe sind durch hohes Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, trockenen Husten, Lungenentzündung (sog. atypische Pneumonien) und auch Schüttelfrost gekennzeichnet. In diesen Fällen kann ein Krankenhausaufenthalt notwendig werden. Bestehende andere Erkrankungen begünstigen schwerere Infektionsverläufe. Akute Verlaufsformen sind sehr gut mit Antibiotika zu therapieren, das Robert-Koch-Institut hat hierzu Empfehlungen veröffentlicht. In weniger als 1% der Fälle entwickelt sich beim Menschen ein chronisches Q-Fieber, es äußert sich in vielfältiger Form, so wurden beispielweise chronische Herzklappen-, Leber- oder Knochenmarksentzündungen wie auch chronische Erschöpfungszustände (chronic fatigue syndrome, CFS) beschrieben. Die chronischen Verlaufsformen sind nur schwer therapierbar.
Auch bei Rindern werden chronische Infektionen beschrieben, es liegt hier eine dauerhafte Erregerausscheidung (z.B. mit der Milch) vor, allerdings ohne dass klinische Symptome auftreten müssen.
Aufgrund der häufigen Antikörpernachweise ist davon auszugehen, dass der Erreger in Rinderbeständen weit verbreitet ist. Neue Infektionsepisoden ergeben sich aufgrund des Nachlassens der betriebsspezifischen Immunität. Chronisch infizierte Kühe gewährleisten die Präsenz des Erregers innerhalb der Herde über längere Zeiträume. Nachwachsende empfängliche Jungkühe, die sich infizieren und den Erreger dann bei der Kalbung ausscheiden, kennzeichnen die folgenden Infektionswellen. Während einer Ausscheidungsepisode auf Herdenebene infizieren sich Kälber bereits frühzeitig (Ausscheidung über Fruchtwasser!) und bilden eine Immunität aus, ohne dass Antikörper nachweisbar sind. Die Remontierung derart immuner Jungrinder führt dann wieder zu einer Ruhephase des Infektionsgeschehens. In dieser Ruhephase bleibt eine Infektion der Kälber aus, so dass wiederum voll empfängliche Jungrinder nachwachsen. Letztlich kann man in diesen Herden über die Zeit einen wellenförmigen Verlauf der Infektion beobachten. Unabhängig von diesem betriebsinternen Infektionskreislauf führt natürlich auch die Neuinfektion einer negativen Herde von außen zu einer massiven Erregerausscheidung.
Vor diesem Hintergrund ist es ein vorrangiges Ziel, die innerbetrieblichen Infektionskreisläufe in Rinderbeständen einzudämmen, um die Erregerausscheidung mit der Milch und beim Kalben zu reduzieren.
Für die Impfung von nicht-tragenden Rindern ist ein Impfstoff verfügbar. Der Impfstoff verhindert eine Infektion nicht sicher, aber er reduziert die ausgeschiedene Erregermenge. Weiterhin deutet sich an, dass die Impfung die Entstehung chronischer Dauerausscheider (z.B. über Milch) bei Kühen verhindern bzw. zumindest reduzieren kann. Der beste Impfschutz wird erreicht, wenn die Grundimmunisierung vor der Belegung abgeschlossen wurde. Grundsätzlich reduziert eine Impfung vor Beginn der Trächtigkeit die Erregerausscheidung während des Kalbens. Der Antibiotikaeinsatz im infizierten Bestand, z.B. um eine mögliche Erregerausscheidung um die Geburt zu reduzieren, wurde in einem Gutachten der EFSA (2010) abgelehnt.
Gemäß §3 des Tiergesundheitsgesetzes gilt, dass wer Vieh oder Fische hält, zur Vorbeugung vor Tierseuchen und zu deren Bekämpfung dafür Sorge zu tragen hat, dass Tierseuchen weder in seinen Bestand eingeschleppt noch aus seinem Bestand verschleppt werden. Vor diesem Hintergrund sollten sich Rinderhalter – neben den üblichen Maßnahmen zur Biosicherheit – risikoorientiert Klarheit hinsichtlich einer möglichen Coxielleninfektion ihres Bestandes verschaffen (Erhebung des Infektionsstatus).
In Anbetracht der vorgenannten Fakten empfehlen die Rindergesundheitsdienste in Deutschland folgende Vorsichtsmaßnahmen:
Das Kalben sollte in einem Kalbebereich mit kontrolliertem Personenverkehr separat stattfinden. Bei Mutterkühen kann dafür auch ein separat abgezäunter Weidebereich ohne Publikumsverkehr genutzt werden.
Klinisch unauffällige Muttertiere und Nachkommen sollten frühestens 14 Tage nach der Kalbung Kontakt zu betriebsfremden Personen haben.
Beim Umgang mit Nachgeburten, Lochialsekret und neugeborenen Tieren besteht auch für den Tierhalter in klinisch unauffälligen Herden ein schwer abzuschätzendes Infektionsrisiko, welches durch konsequente Geburtshygiene minimiert werden kann. Hierzu gehören u. a. eine saubere Einstreu, die Reinigung und Desinfektion der Kalbebuchten, eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Hände, ein sofortiges Entfernen von Totgeburten und Eihäuten aus dem Stall und deren Zwischenlagerung in Edelstahlbehältern oder Plastiktonnen bis zur Abholung durch die Tierkörperbeseitigungsanstalt. Keinesfalls sollte das potentiell infektiöse Material offen gelagert werden. Anschließend sind die Behälter unverzüglich zu reinigen und mit einem DVG-geprüften Desinfektionsmittel zu desinfizieren. Auf die Pflicht, Aborte gemäß Brucellose-VO untersuchen zu lassen, wird hingewiesen.
Das zuständige Veterinäramt im Vorfeld frühzeitig informiert und in die Planung der zu beachtenden Maßnahmen einbezogen wird. Vorzugsweise sollten derartige Tierbestände Antikörper- und Erreger-negativ (PCR) sein, mindestens jedoch sollten Ausstellungstiere zeitnah vor der Ausstellung Erreger-negativ sein. Insbesondere im Falle von dauerhaftem Publikumsverkehr auf Betrieben (Hofladen, Ferien auf dem Bauernhof usw.) sind regelmäßige Kontrolluntersuchungen und gegebenenfalls Impfungen in Betracht zu ziehen.
Im Falle einer Infektion im Bestand sollte ein betriebsindividuelles Sanierungskonzept unter Einbeziehung der Tiergesundheitsdienste erarbeitet werden. Hierbei ist neben den Hygienemaßnahmen auch die Impfung zu berücksichtigen.
Dieses Infoblatt wurde zusammengestellt von der AG Infektionskrankheiten der Rindergesundheitsdienste in Deutschland unter Mitwirkung von
Stand Juni 2016

Umfrage zur Behandlung von Eutererkrankungen bei Milchkühen in Deutschland
U. Falkenberg, W. Heuwieser, V. Krömker, C. Fischer-Tenhagen
Die Mastitis spielt in Milchviehbetrieben weltweit eine große Rolle (van Soest et al., 2016). Neben wirtschaftlichen Auswirkungen (Huips et al., 2010) durch Leistungsminderung, sind die klinische Mastitis und die strategische antibiotische Behandlung zum Trockenstellen die wichtigsten Gründe für den Einsatz von Antibiotika bei der Milchkuh (Pol and Ruegg, 2007, Zwald et al., 2004).
Die zunehmende Wahrnehmung der Bedeutung der Antibiotikaresistenz von Keimen macht derzeit einen gezielten, reduzierten Antibiotikaeinsatz beim Milchrind als Nutztier nötig (Zwald et a. 2004). Gemäß einer EU Vorgabe (EU 2015/C 299/04) soll einen adäquaten Einsatz von antibiotisch wirksamen Substanzen in der Veterinärmedizin, auch im Mastitisbereich bewirken. Die Maßnahmen zielen auf gutes Eutergesundheitsmanagement, das Vermeiden von genereller prophylaktischer Antibiose zum Trockenstellen, einer bakteriologischen Diagnostik im Fall einer klinischen Mastitis und der Anpassung der Mastitistherapie an den nachgewiesenen Erreger und die Resistenzlage.
Es besteht Bedarf an wissenschaftlich erhobenen Daten zu Fragen der Eutergesundheit und zum Antibiotikaeinsatz bei der Behandlung der Mastitis des Rindes. Eine systematische Literatursuche zeigte, dass es derzeit keine soliden wissenschaftlichen Informationen aus Deutschland zu diesem Thema gibt.
Deshalb führten der Tiergesundheitsdienst der Tierseuchenkasse MV und die Tierklinik für Fortpflanzung der FU Berlin diese Studie an einer belastbaren Stichprobe von Milcherzeugerbetrieben durch.
Material und Methoden
Der Rindergesundheitsdienst der Tierseuchenkasse Mecklenburg-Vorpommern und die Tierklinik für Fortpflanzung der FU Berlin erarbeiteten einen Fragebogen mit 29 Fragen. Im ersten Abschnitt des Fragebogens wurden allgemeine Daten zum Betrieb erhoben. In zweiten Abschnitt wurden Fragen zum Melken gestellt. Im dritten Abschnitt wurden Strategien des Eutergesundheitsmanagements erfragt. Der vierte Abschnitt enthielt Fragen zur Behandlung von Eutererkrankungen, der Beurteilung der Eutergesundheit im Betrieb und der Effizienz der Mastitisbehandlung.
Der Fragebogen wurde über die Rindergesundheitsdienste Deutschlands und die Milchkontrollverbände im Dezember 2015 per Post versendet. Einige Fragebögen wurden bei Fortbildungsveranstaltungen für Landwirte im Frühjahr 2016 verteilt. Wir erreichten etwa 1500 Landwirte. Bis zum Rücksendeschluss erreichten 499 Fragebögen die Tierklinik für Fortpflanzung (Rücklaufquote: 33,3%). Die Teilnahme an der Befragung war freiwillig und anonym.
Die Daten wurden mit SPSS ausgewertet (V. 24,0, IBM Deutschland GmbH, Ehningen, Deutschland). Wir berechneten Mittelwerte und Standardabweichungen für kontinuierliche und ordinale Variablen (Mittelwert + Standardabweichung). Für binäre und kategoriale Variablen kalkulierten wir Häufigkeitsverteilungen.
Ergebnisse
Die Betriebe
Die teilnehmenden Betriebe (n=499) lagen in Thüringen (33,5%), Sachsen-Anhalt (19,2%), Mecklenburg-Vorpommern (16,6%), Niedersachsen (13,6%), Nordrhein-Westfalen (4,2%), Hessen (1,2%), Bayern (7,2%), Baden-Württemberg (4,0%) und Sachsen (0,4%).
Die teilnehmenden Betriebe melkten zum Zeitpunkt der Befragung im Mittel 293,6 (± 283, Standardabweichung, SA) Kühe. 55 Betriebe (11,0%) hatten bis 50 Tiere im Bestand, 88 Betriebe (17,6%) zwischen 51 und 100 Kühen, 256 Betriebe (51,3%) zwischen 101 und 500 Kühen und 83 Betriebe (16,6%) über 500 Kühe. 17 Betriebe machten keine Angaben zur Betriebsgröße. 469 Betriebe (94%) arbeiteten konventionell und 22 Betriebe (4,4%) nach Biorichtlinien.
8 Betriebe (1,6%) machten keine Angaben.
Bei den Angaben zur Milchleistung konnten 466 Fragebögen berücksichtigt werden. Die mittlere Milchleistung pro Tag betrug von 29,6 l (± 4,3 l, SA) mit einem Minimum von 10,2 l und Maximum von 39,4 l. Die Zellzahl der Tankmilch im letzten Monat betrug im Mittel 212,2 x 103 Zellen/ ml. Die Neuinfektionsrate in der Laktation im letzten Laktationsmonat wurde von 294 Betrieben (58,9%) angegeben. Sie lag bei 18,9% (±10,3%, SA).
Tierärztliche Betreuung auf den befragten Betrieben
10,6% der Betriebe hatten einen täglichen tierärztlichen Besuch, 16,8% zweimal in der Woche. Bei 32,1 % der Betriebe kam die Tierärztin einmal die Woche und bei 15,6% einmal im Monat. 15,6% der Betriebe hatten keine routinemäßige Vereinbarung und die Tierärztin kam nur bei Notfällen. Eine Beratung zur Eutergesundheit wurde in den meisten Fällen von der behandelnden Tierärztin (91,6%) durchgeführt. Weitere Beratung erhielten die Betriebe vom Rindergesundheitsdienst (33,1%), landwirtschaftlichen Beratern (27,5%) und sonstigen (20,0%).
Melken
436 (87,4%) der teilnehmenden Betriebe melkten die Kühe auf einem Melkstand. Dabei melkten 401 Betriebe zweimal und 35 Betriebe dreimal pro Tag. 63 Betriebe (12,6%) hatten ein automatisches Melksystem. Im Mittel melkten in den befragten Betrieben 4,5 (± 3,6, SA) Melker. Erwartungsgemäß beeinflusste die Größe des Betriebes und die Art des Melkens (Melkstand oder automatisches Melksystem) die Anzahl der Melker pro Betrieb. Bei den befragten Betrieben hatten 70,8% der Melker eine landwirtschaftliche Ausbildung. Schriftliche Anweisungen für das Melken gab es auf einem Viertel der Betriebe (25,9%).
Diagnostik von Eutergesundheitsstörungen
In 352 der Betriebe (70,5%) wurden Milchproben zur Bestimmung von Mastitiserregern entnommen. Bei den verschiedenen zur Verfügung stehenden Methoden lag der Fokus auf der bakteriologischen Untersuchung der Milch (307 Betriebe). Die Untersuchung mittels Polymerase Kettenreaktion Technik (PCR) und spezielle Zellzahluntersuchungen spielen eine untergeordnete Rolle (PCR: 31 Betriebe, 8,8%, Zellzahluntersuchungen: 188 Betriebe, 53,4%).
Art der Milchprobe für die Bakteriologie
242 Betriebe nahmen nur Viertelgemelke für die bakteriologische Untersuchung. Bei den anderen Betrieben wurden entweder nur Gesamtgemelke entnommen oder die Art der Milchprobe war von der jeweiligen Fragestellung abhängig. Am häufigsten wurden Kühe mit klinischen Mastitiden beprobt (84,1%). Weitere Gründe für eine Milchprobe waren hohe Zellzahlen (57,7%), routinemäßige Beprobung nach der Abkalbung (31,8%) oder vor dem Trockenstellen des Tieres (16,5%). Am häufigsten wurde genannt, dass der Melker die Milchproben zur bakteriologischen Untersuchung entnahm.
Erreger von Mastitiden
Von den 352 Betrieben machten 294 Betriebe (83,5%) Angaben zu Erregern, die häufig in den Befunden der Milchproben erschienen. 26 (8,9%) Betriebe nannten einen Erreger, 83 (28,2%) mal wurden 2 Erreger genannt und 185 (62,9%) mal wurden 3 Erreger aufgezählt. Am häufigsten wurden Strep. uberis, S. aureus und KNS genannt.
Behandlung von Mastitiden Alle Betriebe gaben an, Kühe mit klinischen Mastitiden zu behandeln. 424 Betriebe gaben „viele Flocken“ als Grund für eine Mastitisbehandlung an. Die Mastitiden wurden von den befragten Betrieben meist unmittelbar bei der Diagnosestellung behandelt (374 Betriebe). In einigen fand die Behandlung erst in der nächsten Melkzeit statt (94 Betriebe). In 25,9% der Betriebe gab es eine schriftliche Arbeitsanweisung zur Behandlung von Eutererkrankungen. 74,1 % verneinten diese Frage.
Medikamente bei Mastitiden
454 Betriebe (91,0%) benannten antibiotische Medikamente zur Behandlung von Eutergesundheitsstörungen. 45 Betriebe (9,0%) machten keine Angaben. Es wurden auch nicht immer (wie erbeten) drei Medikamente genannt.356 nennen Antibiotika aus den Stoffklassen der Penicilline, ß-Laktam Antibiotika, Makrolide und Lincomycine. 363 führten bei den drei möglichen Nennungen Fluorchinolone oder Cephalosporine der 3./4.Generation auf. Die Häufigkeit der Anwendung der Medikamente leitet sich durch die Fragestellung nicht ab.
Zusammenfassung und Ausblick
Mit der vorliegenden Untersuchung wollten wir relevante Aspekte des Eutergesundheitsmanagements in Milchviehbetrieben und Eckdaten bei der Behandlung von Mastitiden in Deutschland beschreiben. Die Analyse der Euterkennzahlen mit dem Bericht des LKVs ist ein wichtiger Schritt, um Schwachstellen im Betrieb zu erkennen. Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass die Eutergesundheitskennzahlen der LKVs von einigen Betrieben genutzt werden (58% der Betriebe kennen die Neuinfektionsrate in der Laktation). Es besteht allerdings noch erhebliches Potential, dieses Werkzeug besser zu nutzen. Arbeitsroutinen für Melken und die Behandlungen von Mastitiden in schriftlicher Form gab es in sehr wenigen Betrieben. Die bakteriologische Untersuchung von Milchproben wurde bei über 70% der befragten Betriebe durchgeführt. Es wurde meist Proben bei Tieren mit klinischer Mastitis genommen. Milchproben zum Trockenstellen spielen eine untergeordnete Rolle.
Die Tierarztpraxen sind beim Thema Eutergesundheit in den Betrieben eingebunden. Die Tierarztpraxis ist der am häufigste genannte Berater zum Thema Eutergesundheit (> 90% der Betriebe). Die befragten Betriebe setzen zur Behandlung von klinischen Mastitiden Antibiotika ein. Eine Angabe zur Intensität und zu Schwerpunkten des Einsatzes bestimmter Klassen von Antibiotika können wir hier nicht geben.
Aus den Ergebnissen der Studie ergeben sich folgende Aufgaben für die Beratung zur Eutergesundheit in Milchviehbetrieben:
Literatur
Veröffentlicht im Tagungsband der AG Sachverständige subklinische Mastitis der DVG, März 2018 in Berlin.

Sehr geehrte Tierhalterin, sehr geehrter Tierhalter,
ab dem 25. Mai 2018 gilt die neue Europäische Datenschutzgrundverordnung -DSGVO- (Verordnung (EU) 2016/679, ABl. der EU L 119 vom 4.5.2016 S. 1). Danach ist die Tierseuchenkasse von M-V verpflichtet, Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und Ihre Datenschutzrechte zu informieren.
Die Tierseuchenkasse von M-V hat die Aufgabe Tierverluste durch anzeigepflichtige Tierseuchen oder seuchenartige Erkrankungen sowie Kosten der Tötung und Verwertung, die bei der Bekämpfung dieser Tierseuchen oder seuchenartigen Erkrankungen entstehen, zu erstatten. Darüber hinaus kann sie u. a. Kosten zu planmäßigen Vorbeuge- und Bekämpfungsmaßnahmen gegen Tierseuchen und seuchenhaft verlaufenden Tierkrank-heiten oder Zoonosen übernehmen. Die Aufgaben der Tierseuchenkasse von M-V sind in § 9 des Ausführungsgesetzes zum Tiergesundheitsgesetz M-V (TierGesGAG M-V) normiert.
Zur Erfüllung dieser Aufgaben werden personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt. Insbesondere werden personenbezogene Daten nach § 20 TierGesGAG M-V zum Zwecke der Beitragserhebung und nach §§ 15 ff. TierGesGAG M-V zum Zwecke der Leistungsgewährung erhoben und verarbeitet.
Die Erhebung von personenbezogenen Daten erfolgt überwiegend direkt bei der betroffenen Person. Darüber hinaus werden personenbezogene Daten gemäß § 6 Absatz 1 und 2 TierGesGAG M-V aus folgenden Drittquellen erhoben: Herkunftssicherungs- und Informationssystem Tier (zentrale Datenbank HI-Tier: www.hi-tier.de), Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern, Veterinärämter der Landkreise und kreisfreien Städte, Einwohnermeldeämter und Vollstreckungsbehörden.
Personenbezogene Daten werden bei der Tierseuchenkasse von M-V unter Berücksichtigung der gesetzlichen und insbesondere der haushaltsrechtlichen Vorschriften gespeichert. Die Speicherdauer der bei der Tierseuchenkasse von M-V gesammelten persönlichen Daten orientiert sich an den in den Verwaltungsvorschriften für Zahlungen, Buchführung und Rechnungslegung zu den §§ 70 bis 72 und 74 bis 80 der Landeshaushaltsordnung (LHO). Die Aufbewahrungsfristen betragen 10 Jahre nach Ablauf des Jahres der Entstehung. Werden Daten mit unterschiedlicher Aufbewahrungsdauer zusammen verarbeitet, gilt für die Löschung die jeweils längste Frist.
Angaben aus den Tierbestandsmeldungen dienen zugleich gemäß § 20 Absatz 7 TierGesGAG M-V der Durchführung von Maßnahmen, zu denen die Tierseuchenkasse von M-V Leistungen erbringt. Die Daten können gemäß § 6 Absatz 1 TierGesGAG M-V zur Vorbeuge und Bekämpfung von Tierseuchen an die Veterinärämter und an das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern übermittelt werden.
Betroffene können von der Tierseuchenkasse von M-V Auskunft über ihre verarbeiteten personenbezogenen Daten erhalten (Artikel 15 DSGVO) und deren Berichtigung (Artikel 16 DSGVO) verlangen.
Eine Löschung (Artikel 17 DSGVO) oder Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18 DSGVO) kann für Daten verlangt werden, die nicht für die Erfüllung des gesetzlichen Auftrages der Tierseuchenkasse von M-V notwendig sind.
Für die Datenverarbeitung verantwortlich:
Tierseuchenkasse von M-V
Neustrelitzer Str. 120
17033 Neubrandenburg
Bitte richten Sie Ihre Anfrage an die
Datenschutzbeauftragte der Tierseuchenkasse von M-V
Neustrelitzer Str. 120
17033 Neubrandenburg
datenschutzbeauftragter@tskmv.de
Darüber hinaus steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu. Die zuständige Aufsichtsbehörde erreichen Sie unter folgender Anschrift:
Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern
Werderstr. 74 a
19055 Schwerin
Telefon: +49 385 59494 0
Telefax: +49 385 59494 58
info@datenschutz-mv.de
www.datenschutz-mv.de
www.informationsfreiheit-mv.de

Liebe Imkerinnen und Imker,
haben Sie schon an die Jungvolkbildung gedacht?
Wir bekommen durch diese Maßnahme zwar nur eine überschaubare Anzahl von Milben aus den Altvölkern. Wenn man jedoch bedenkt, dass die Varroa-Population von Anfang April bis Ende August ca. sieben Reproduktionszyklen durchläuft und bis dahin aus einer Milbe leicht über 50 Exemplare werden, könnten später im Jahr genau diese Milben das Zünglein an der Waage gewesen sein.
Wie wir wissen, fliegen die Bienen an ihren Ursprungsort zurück. Einfach mehr Bienen als üblich in den Brutableger abzukehren, kann mal gut, mal weniger gut gelingen, zudem muss die Königin gefunden werden. Eine andere Methode ist es, einen Flugling zu bilden. Hierfür benötige ich weder einen zweiten Standplatz, noch muss nach der Königin gesucht werden. Die Nachteile: Man kann pro Volk nur einen Ableger bilden. Wollen Sie mit dem Flugling noch Honig ernten, bleibt nur die obligatorische Spätsommerbehandlung nach Trachtende. Ohne nachfolgende Honigernte empfiehlt sich in der brutfreien Phase eine Sprühbehandlung mit Milch- oder Oxalsäure.
Wenn Sie die mit Bienen besetzte Beute von ihrem Standort ein paar Meter verstellen und an den Ort der „alten“ Beute eine „neue“ Beute setzen, haben Sie einen Flugling gebildet. Natürlich muss darin etwas sein, das für weisellose Bienen äußerst attraktiv ist. Das wäre entweder eine Wabe mit Eiern bzw. jüngster Brut oder eine Königin.
Und so geht es:
Diese Art der Ablegerbildung genügt sicherlich nicht den Ansprüchen ambitionierter Imker, aber für diejenigen unter Ihnen, die wenige Völker an einem Ort haben, ist es eine sehr einfach anzuwendende Methode der Jungvolkbildung.
Gesunde Bienen und viel Spaß am Imkern
wünscht Ihnen
Tobias Dittmann
Fachberater für Imkerei

1. Wildvogelbewegungen im Umfeld der Geflügelhaltung beobachten (Tote)
2. Eintragsmöglichkeiten für jedem Bestand sehr genau analysieren
– Futtersilos /Leckagen/ Zugang Wildvögel;
– Einstreulagerung neben dem Stall (mind. 6 Wochen Zwischenlagerung unter
Verschluss);
– Arbeitsschutzbekleidung / ggf. im Stall lassen (kleine Haltungen);
– Sentinelhühner bei Enten-/ Gänsehaltung genau beobachten;
– Futter grundsätzlich vor Wildvögeln (v.a. Wasservögeln) abschirmen
besonders Wildenten und Möwen;
– keine fremden Personen zum Geflügel lassen – insbesondere aus Ländern wo
in letzter Zeit Geflügelpest -Fälle aufgetreten sind (z.B. Polen, Russland,
Rumänien; Nachbarschaftsbesuche beachten;
– keine Speisereste an Geflügel verfüttern oder auf Dunghaufen
(Kompostierung) für Vögel /Geflügel zugänglich lagern;
– bei Stallreinigung/ Desinfektion auf Vogelnester (Vorraum/ Decken) achten;
Lüftungseinrichtungen (Staub) bei Reinigung und Desinfektion beachten
3. Einschleppung über Handel/ Ausstellungen
Zukauf/ Einstallung nur aus bekannten Herkünften (Atteste/ Zertifikate) – Gebietsstatus
beachten (ggf. Veterinäramt konsultieren);
Transportfahrzeug/ Transportmittel/ Käfige Sauberkeit/ Desinfektion beachten;
4. Persönliche Hygiene
Hände gründlich waschen (vor- und nach Tierkontakten/ Stallarbeiten) am besten mit
Desinfektionsseifen (z.B. vom Tierarzt oder aus der Apotheke).
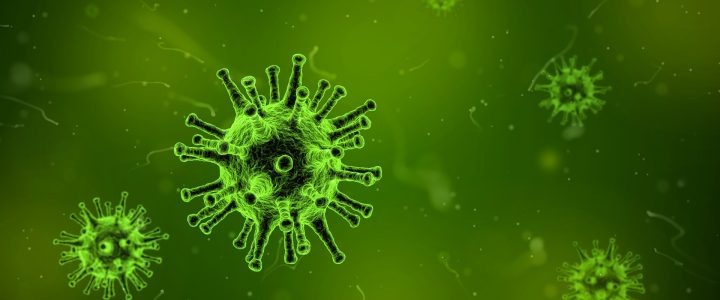
Infektionen mit aviären Influenzaviren, insbesondere mit hochpathogenen Erregern (Geflügelpest), können neben dem Leiden für die betroffenen Tiere zu massiven Verlusten in Geflügelhaltungen und zu schweren wirtschaftlichen Folgen für den Handel führen. Je früher die Infektionen entdeckt werden, umso eher kann es gelingen, das Ausbruchsgeschehen einzudämmen und die Schäden gering zu halten.
Es ist daher von größter Bedeutung, dass die tierseuchenrechtlich vorgeschriebenen Maßnahmen (§ 4 Geflügelpest-Verordnung) zur frühen Erkennung von Infektionen mit aviären Influenzaviren strikt eingehalten werden: Treten innerhalb von 24 Stunden in einem Geflügelbestand Verluste von mindestens drei Tieren bei einer Bestandsgröße von bis zu 100 Tieren oder mehr als 2 % der Tiere des Bestandes bei einer Bestandsgröße von mehr als 100 Tieren auf oder kommt es zu einem erheblichen Absinken der Legeleistung oder der Futter- und Wasseraufnahme, so hat der Tierhalter unverzüglich den Bestandstierarzt oder zuständigen Amtstierarzt zu informieren, der daraufhin Abklärungsuntersuchungen zum Ausschluss anzeigepflichtiger Tierseuchen wie z.B. der Geflügelpest durch geeignete Untersuchungen veranlasst.. Das gleiche gilt für Geflügelbestände, in denen ausschließlich Enten und Gänse gehalten werden, wenn über einen Zeitraum von mehr als vier Tagen Verluste von mehr als der dreifachen üblichen Sterblichkeit der Tiere des Bestandes oder ein Rückgang der üblichen Gewichtszunahme oder Legeleistung von mehr als 5 % eintritt.
Darüber hinaus kommt Biosicherheitsmaßnahmen in allen Geflügelhaltungen, auch Kleinbetrieben, eine hohe Bedeutung zu, um die Einschleppung von aviären Influenzaviren zu vermeiden. Auf das dazu vorliegende Merkblatt des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes MecklenburgVorpommern wird in diesem Zusammenhang verwiesen.
Es wird ferner darauf verwiesen, dass im Tierseuchenfall ein Anspruch auf Entschädigung nach § 15 des Tiergesundheitsgesetzes nur besteht, wenn ein Tierbestand und die Anzahl der gehaltenen Tiere bei der Tierseuchenkasse korrekt gemeldet und die Beiträge fristgerecht entrichtet wurden.

Für alle, die sich in Sachen Bienenweide in M-V informieren oder engagieren wollen, finden Tipps unter https://bienenstrasse.de/bienenstrasse/projekt-bienenstrasse/

Deutschland ist seit dem Frühjahr 2017 ein anerkanntes BHV1-freies Gebiet (Artikel-10-Gebiet nach der
Richtlinie 64/432/EWG). Trotzdem muss in Deutschland immer noch in einzelnen Fällen der Ausbruch
oder der Verdacht des Ausbruchs der BHV1-Infektion in Rinder haltenden Betrieben festgestellt werden.
In dem BHV1-freien Gebiet sind die Rinderbestände aufgrund des bestehenden Impfverbotes ungeschützt
und somit voll empfänglich für eine BHV1-Infektion. Diese derzeit sehr sensible Phase in der
Aufrechterhaltung des BHV1-freien Status macht die Durchführung von Biosicherheitsmaßnahmen zur
Infektionsprophylaxe für jeden Rinderhalter absolut notwendig.
Geringe Nachlässigkeiten im Seuchenschutz können zu großen Schäden führen. Deshalb sollten Sie die
Biosicherheitsmaßnahmen in Ihrem Betrieb überprüfen und alles dafür tun, dass Tierseuchenerreger
weder in den Bestand eingeschleppt, noch aus dem Bestand verschleppt werden können. Diese Forderung
wurde für alle Tierhalter in § 3 des Tiergesundheitsgesetzes festgeschrieben. Im Folgenden haben wir
wichtige Eckpunkte für Sie zusammengefasst:
Personenverkehr
Viehverkehr
Andere Übertragungsmöglichkeiten?

WIE WIRKT OXALSÄURE?
Oxalsäure ist ein Kontaktgift. Die genaue Wirkungsweise auf die Milben ist noch
nicht wirklich erforscht. Eine interessante Theorie lautet, dass die Varroamilbe die
Oxalsäurepartikel über ihre Haftlappen aufnimmt und auf diesem Weg das Gift in
den Organismus gelangt. Die Bienen verfügen zwar ebenfalls über Haftlappen,
diese werden aber nur auf sehr glatten Oberflächen benutzt. Auf den rauen
Oberflächen im Bienenstock sind diese zwischen den beiden Fußkrallen gefaltet, so
sollen zumindest auf diesem Weg keine oder kaum Wirkstoffe aufgenommen
werden können. Die Todesursache der Varroamilben könnte Dehydration sein,
denn auch bei den Bienen wurde eine
erhöhte Wasseraufnahme nach einer
Oxalsäurebehandlung festgestellt.